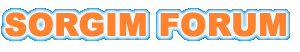Die neue wirtschaftliche Dynamik zieht Menschen aus der ganzen Welt an – China könnte zum Einwanderungsland werden - NZZ, Matthias Messmer, Staatswissenschafter und lebt in Schanghai. Im Wiener Böhlau-Verlag ist vor kurzem der umfangreiche Band «China. Schauplätze west-östlicher Begegnungen» erschienen.
Im Gegensatz zum immer erfolgloseren Westeuropa, wo Reiche und Superreiche nur noch über Steuerreduktionen diskutieren und wie man Steuern am besten hinterziehen kann, setzt China nach der Devise "Ubi concordia, ibi victoria" (wo Harmonie herrscht, kommt Sieg) und auf das von Napoleon Hill formulierte Geheimnis des ERFOLGES: Denk nach und werde reich auf Integration und wird zum globalen Anziehungspunkt, zum Magneten des Erfolges!China könnte zum Einwanderungsland werden von Matthias Messmer hat geschrieben:Die Attraktivität Chinas hat in den letzten Jahren auch für ausländische Arbeitskräfte zugenommen. Das ist eine für das Reich der Mitte völlig unbekannte Entwicklung und konfrontiert die Regierung mit neuen Herausforderungen: Aus politischen Gründen muss die Kommunistische Partei fremde Einflüsse kontrollieren, ist aber, um das wirtschaftliche Wachstum sicherzustellen, gleichzeitig auf den Austausch mit der Aussenwelt angewiesen.
Ausländer fallen im Strassenbild chinesischer Grossstädte kaum mehr auf. Chinesen haben sich in den Metropolen Peking, Schanghai oder Kanton (Guangzhou) im Zuge der Öffnungspolitik und einer fortgeschrittenen Globalisierung längst an die «waiguoren» gewöhnt. Selbst den Einheimischen seltsam vorkommende Sitten der Westler, wie beispielsweise morgens Kaffee statt Tee zu bestellen, Brot statt Nudeln zu essen oder sich beim Gruss die Hände zu schütteln, lösen bei vielen Einheimischen schon längst keine Reaktion des Erstaunens mehr aus. Zumindest nicht solche, die der Fremde bemerkt. Hinter vorgehaltener Hand machen sich Chinesen allerdings noch immer lustig über jene Langnasen, die, um fit zu bleiben, gelegentlich die Treppe dem Lift vorziehen oder die beim Niesen das Taschentuch hervorziehen, statt sich mit einem kräftigen Auspusten des Nasenschleims zu entledigen.
Missionare und Diplomaten
Jahrhundertelang hatten es Chinas Herrscher für unnötig erachtet, Beziehungen mit dem Ausland zu suchen, geschweige denn Fremde in ihrem Reich zu dulden. Der Kaiserhof betrachtete sich als Zentrum der Welt, und folglich war das Reich der Mitte auch nicht auf die «Barbaren» angewiesen. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert, als der Westen mit militärischer Gewalt auf Öffnung des Landes für den internationalen Handel drängte und China wohl oder übel diesem Druck nachgeben musste. Doch im Unterschied beispielsweise zu Indien war der Fluss westlicher Besucher oder gar Aufenthaltswilliger verhältnismässig gering: Hauptsächlich Missionare und Diplomaten knüpften in jenen Jahren engere Bande zu China und seiner Bevölkerung. Während der Republikzeit (1911–1949) reisten vermehrt auch ausländische Berater, Journalisten, Abenteurer, Spione und Flüchtlinge nach China, doch war ihr Einfluss auf die Vorgänge innerhalb des Landes relativ bescheiden. Die Machtübernahme der Kommunisten läutete gleichzeitig eine Eiszeit in den Beziehungen Pekings mit dem Westen ein. Maos Devise lautete «Vertrauen auf die eigene Kraft», was vor allem die wirtschaftliche und politische Autarkie des Landes und den Rauswurf der «schädlichen und raffgierigen Ausländer» bedeutete. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit für Ausländer waren in China bis in die neunziger Jahre üblich. Bei einigen Politikern setzte sich allerdings bereits früher dank der Reformpolitik Deng Xiaopings Ende der siebziger Jahre die Überzeugung durch, dass in Zeiten weltwirtschaftlicher Verknüpfungen eine völlige Abschottung des Landes kontraproduktiv ist.
Offizielle und inoffizielle Zahlen
Es dauerte nochmals zwei Jahrzehnte, bis die Regierung in den späten neunziger Jahren erkannte, dass China aufs Ausland angewiesen war, wollte es am geopolitischen Spiel aktiv teilnehmen und von der Welt als verantwortungsvolle Grossmacht anerkannt werden. Dazu gehörte, dass im Zuge des Beitritts zur WTO im Jahre 2001 Erleichterungen eingeführt wurden für jene Ausländer, die planten, längerfristig in geschäftlicher Angelegenheit im Reich der Mitte tätig zu sein. Das bedeutete selbstverständlich nicht, dass man umgehend niederlassungswilligen Ausländern eine Daueraufenthaltsgenehmigung ausstellte. Immerhin jedoch wurden bestehende Visumsrestriktionen gelockert und in bestimmten Fällen längerfristige Aufenthaltsgenehmigungen erteilt. Im Jahre 2004 setzte das Ministerium für Staatssicherheit die Öffentlichkeit von der Absicht in Kenntnis, ein «Green-Card-System» einzuführen. Allerdings sind die Hürden, um einen solchen Persilschein zur freien Ein- und Ausreise zu bekommen, ziemlich hoch: Erst jene Ausländer, die beispielsweise als sogenannte «Experten» in irgendeiner Weise zum Wohle des Staates beigetragen oder die eine Direktinvestition von einer halben Million Dollar im Land getätigt haben, können in den Genuss einer solchen Daueraufenthaltsgenehmigung gelangen. Im Jahre 2005 waren in China 380 000 Ausländer registriert, die sich mehr als ein Jahr im Lande aufhielten. 2006 betrug die Zahl der Ausländer, die nach China ein- oder ausreisten, ungefähr 44 Millionen, was einen Anstieg von fast 98 Prozent gegenüber 2001 bedeutete. In der Hauptstadt Peking waren im letzten Jahr über 70 000 Ausländer offiziell registriert, während in Schanghai die Zahl deutlich höher lag. Inoffizielle Stellen sprechen von mehr als 300 000 hier lebenden Ausländern (nicht eingerechnet die Taiwaner, ungefähr eine halbe Million, die hierzulande als «Landsleute» gelten).
Die Metropole Huangpu rühmt sich gerne, für Ausländer die besten Arbeits- und Wohnvoraussetzungen in China anzubieten («kosmopolitische Atmosphäre»). Ähnlich preisen Städte wie Qingdao («geringe Luftverschmutzung»), Shenzhen («Nähe zu Hongkong») oder Chongqing («Chinas Wilder Westen») ihre jeweiligen Vorteile an, um ausländische Firmen, selbstverständlich in erster Linie deren Kapital, anzuziehen. Es kann der Regierung zum jetzigen Zeitpunkt nur recht und billig sein, ausländisches Know-how und Investitionen an Land zu ziehen, um den wirtschaftlichen Aufschwung auch in Chinas ärmeren Provinzen voranzutreiben. Doch auch nach der schrittweisen Einführung marktwirtschaftlicher Regelungen gelten hierzulande besondere chinesische Charakteristika: etwa das «waishi»-Prinzip (alles, was von aussen kommt), wonach die Führung des Landes die zunehmende Verflechtung mit dem Ausland sowohl als Gelegenheit wie auch als Bedrohung sieht. Oberstes Ziel muss es für Staat und Partei demgemäss immer sein, dass Ausländer in erster Linie chinesischen Interessen dienen. Bis vor einigen Jahren wurden die meisten in China lebenden Ausländer in speziellen Wohnsiedlungen untergebracht. Heute leisten sich Manager westlicher Firmen und andere Spitzenverdiener lieber eine Villa in der ehemaligen französischen Konzession von Schanghai oder ein viereckiges Wohnhaus im traditionellen Stil in den Gassen Pekings – wohlgemerkt zu amerikanischen Preisen in Millionenhöhe. Nebst solchen Business-«Expats» der herkömmlichen Art zieht China allerdings mehr und mehr auch Ausländer aus der breiteren Mittelschicht an: Ob Lehrer oder Fotografen, Küchenchefs oder DJ, Studienabgänger oder Pensionierte – nicht wenige lassen sich von Chinas Dynamik mitreissen oder erhoffen sich einen Ansporn für eine neue Betätigung fern der Routine im für sie träge erscheinenden Westen. Der deutsche Filmemacher Lothar Spree hat im «Paris des Ostens» beispielsweise eine neue Heimat gefunden, während der einstige Top-Designer der Firma Bodum, Carsten Joergensen, hier in Schanghai seine zweite Jugend mit einem weiteren Kreativitätsschub erleben möchte. Seit einiger Zeit spricht man übrigens nicht mehr nur von den Geschäftsleuten im engeren Sinne, sondern von den sogenannten «Half-Expats», jenen Ausländern also, die im Gegensatz zu den «Expats» am Flughafen nicht wie selbstverständlich mit dem Mercedes abgeholt werden, dafür meist Chinesisch sprechen. Und allerdings nur gerade die Hälfte vom Einkommen ihrer wohlhabenden «Brüder» verdienen.
Japaner, Araber und Schwarze
Die grösste Gruppe an Ausländern in Schanghai stellen die Japaner dar. Im Schnellzug von Schanghai nach Nanjing oder Hangzhou sind sie frühmorgens schon unterwegs zu «ihren» Firmen Mitsubishi, Hitachi, Sony, Canon und wie sie alle heissen. Produziert wird aus einsichtigen Gründen schon längst in China. Japaner sind bei der Regierung – aus historisch-politischen Gründen – ziemlich unbeliebt. Auch ein Blick auf chinesische Websites verrät, dass die Gefühle der Chinesen gegenüber den Nachbarn alles andere als ungetrübt sind. Es gibt Blogs zum Thema der «herablassenden Japaner», welche Chinesen verprügelten, zu den «japanischen Piraten» (wokou) oder zum Boykott japanischer Waren. Manch eine Schanghaier Grazie träumt hingegen von der grossen Liebe zu einem Japaner oder eher – berechnend wie viele – vom damit erhofften Reichtum: Das erhöht die Aussicht auf teure Kleider, eine geräumige Wohnung oder luxuriöse Reisen. Die Gastronomie hat sich nicht nur in der Metropole Huangpu längst auf die Geschäftsleute aus Nippon eingestellt. Auch Bars, Karaoke-Häuser und Massagesalons werben in japanischen Schriftzeichen für Kundschaft von der Insel.
Geschäftstüchtige Muslime
Weniger zahlungskräftig als die Japaner ist die Gruppe jener Ausländer, die sich seit ungefähr drei Jahren in einer für chinesische Verhältnisse kleinen Stadt (1,6 Millionen Einwohner) in der Provinz Zhejiang «etabliert» hat. Die Rede ist von Muslimen aus dem Nahen und Mittleren Osten, die in Yiwu, dem grössten Markt an Bedarfsartikeln auf der ganzen Welt, ihren Geschäften nachgehen. In den ungefähr 20 000 Ständen, wo unter anderem leuchtende Jesus- und Marienfiguren neben Mao-Uhren, muslimischen Gebetsutensilien und Plastic-Ganeshas verkauft werden, drängen sich arabisch sprechende Händler auf dem grössten Basar des Fernen Ostens (angeblich werden hier 320 000 verschiedene Produkte angeboten). Sie kaufen Billigprodukte «made in China» und vertreiben sie mit Profit nach Libanon, Syrien, Jordanien oder Pakistan. Ungefähr 20 000 Menschen muslimischen Glaubens (inklusive jener aus dem Westen Chinas) leben in Yiwu. Seit zwei Jahren steht ihnen eine Moschee zur Verfügung. Früher diente das Gebäude als Depot für eine Seidenfabrik, heute erscheinen häufig bis zu 8000 Gläubige zum Freitagsgebet. In den letzten Monaten verzichtete man auf den Aufruf zum Gebet über Lautsprecheranlagen, um die unmittelbare Umgebung – wie Herr Wu, ein Mitarbeiter der muslimischen Gemeinde aus Ningxia, freimütig erklärt – nicht unnötig zu verärgern. Salwan al-Azawi lebt bereits knapp ein Jahr in Yiwu. Er und sein Vater haben Bagdad verlassen, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Zurückgelassen haben sie, nebst der täglichen Angst um die eigene Sicherheit, die weiblichen Mitglieder der Familie. Jetzt betreiben sie hier das gemütliche «Bagdad-Restaurant» und bedienen Muslime aus der ganzen Welt. Das Servierpersonal stammt aus dem Westen Chinas: Einige Mädchen aus dem muslimischen Minderheitenvolk der Hui tragen den Schleier, andere wählen die poppigere Art mit engen Jeans und unverhülltem Haar. China – das Land der Freiheit, wie es scheint. Während des Mittagessens flimmern die Nachrichten des arabischen Fernsehkanals al-Jazira über den Bildschirm. Ungefähr 1000 Iraker haben in den vergangenen vier Jahren in Yiwu eine neue Heimat gefunden – und hoffen zu bleiben. Ihr Wunsch dürfte dank der grosszügigen Handhabung der Stadtregierung bezüglich Aufenthaltsgenehmigung leichter als anderswo in Erfüllung gehen. – Bedeutend mehr als alle Westler, Japaner und Araber zusammen fallen im Reich der Mitte schliesslich Angehörige dunkelhäutiger Volksgruppen auf. Von einer eigentlichen afrikanischen Enklave kann gesprochen werden, wenn man sich in Kanton, der Provinzkapitale Guangdongs, in der Nähe des Tianxiu-Gebäudes umsieht: Frauen in farbigen, exotisch wirkenden Kleidern und Männer, die in der einen Hand ihr Mobiltelefon, in der anderen riesige schwarze Plasticsäcke voller Billigwaren, zumeist Kleider, in der südchinesischen Handelsstadt herumschleppen – auf dem Weg von den Markthallen zu einem Transportunternehmen, das die Fracht nach Übersee, nach Nigeria, Südafrika oder in den Sudan, garantieren soll. Über die Anzahl der in Kanton tätigen Afrikaner gibt es keine gesicherten statistischen Angaben. Ausser Frage ist lediglich, dass ein Teil von ihnen in den Drogenhandel verwickelt ist, was jedem vorurteilslosen Besucher anlässlich eines Spaziergangs nach Einbruch der Nacht in der Gegend des Garden-Hotels auffallen muss. Dass solche unerlaubten Geschäfte bei Chinesen, wie an anderen Orten auf der Welt ebenso, rassistische Ressentiments hervorrufen, ist selbstverständlich keine Entschuldigung, wohl aber eine voraussehbare Reaktion. Und auch im Falle der Afrikaner verwundert es deshalb kaum, dass in Blog-Einträgen chinesischer Websites von «hässlichen», «wenig zivilisierten», «häufig Geschlechtskrankheiten tragenden» oder gar «Mädchen-besessenen» Schwarzen die Rede ist: «Ich hoffe, dass alle helfen, die Schwarzen zu vertreiben», schreibt ein sichtlich verzweifelter Chinese. Dass solche Stereotype in staatlichen Printmedien häufig der Zensur zum Opfer fallen, hilft allerdings einer objektiven Diskussion über dieses Thema wenig. Die zunehmende Anzahl der sich in China niederlassenden Ausländer stellt sowohl die Bevölkerung wie die Regierung vor neue Herausforderungen. Das beginnt mit administrativen und rechtlichen Problemen, wie beispielsweise der Frage nach der Beschränkung der Deviseneinfuhr, dem limitierten Erwerb von Immobilien oder auch besonderen gesundheitspolitischen Vorschriften (bis vor kurzem verwehrte China beispielsweise mit dem HI-Virus infizierten Ausländern die Einreise). Weit schwieriger aber wird es sein, die sozialpolitischen Implikationen angesichts eines zunehmenden Stroms von Ausländern nach China vorauszusehen.
Latenter Fremdenhass
Rassistische Stereotype finden auch bei den als tolerant geltenden Chinesen immer wieder Anklang. Man denke beispielsweise an die antijapanischen Ausschreitungen vor zwei Jahren anlässlich der Herausgabe neuer Schulbücher in Japan mit fragwürdigem Inhalt zur japanischen Besetzung Chinas im Zweiten Weltkrieg oder an die antiamerikanische Stimmung nach der Bombardierung der chinesischen Botschaft durch Nato-Flugzeuge in Belgrad im Jahre 1999. Auch die Afrikaner waren schon einmal Zielscheibe erzürnter Chinesen, und zwar Ende 1988 anlässlich eines Streits zwischen afrikanischen Studenten und einem einheimischen Wachmann an der Universität von Nanjing. Und das trotz der bereits von Mao Zedong von oben gepredigten «Solidarität mit der Dritten Welt». Solche Gewalttätigkeiten gegenüber Ausländern sind auch in Zukunft möglich. Daran ändern auch die politisch verbrämten Phrasen der heutigen Regierung etwa von der «harmonischen Gesellschaft» oder der «wissenschaftlichen Entwicklungsidee» wenig. Sie müssen zwingend mit Inhalt gefüllt werden, und dazu braucht es vor allem die notwendige Erziehung und die für Chinesen neue Erfahrung, dass eine globalisierte Welt nicht nur Vorteile für China, sondern auch Verpflichtungen mit sich bringt und vor allem die Verantwortung des Individuums erfordert.