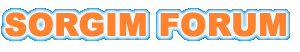Verlierer des Universums - Von Jordan Mejias, New York, Frankfurter Allegemeine Zeitung
Wie schlimm wird es noch werden? Diese Frage, die zurzeit nicht nur an der Wall Street jedem auf den Lippen brennt, hat der „New Yorker“ gleich drei Autoren gestellt. Natürlich wissen auch sie nicht, wie die Geschichte ausgeht. John Cassidy ist sich allerdings sicher, dass die Wirtschaft „unbestreitbar“ in eine neue Phase eingetreten sei: „John Kenneth Gailbraiths Bemerkung, in Amerika sei der einzige angesehene Typus des Sozialismus der Sozialismus für die Reichen, schien niemals genauer den Punkt zu treffen.“ Warum das so kommen musste, erklärt uns Cassidy auch. Leichtgläubigkeit und Gier hätten diese letzte Katastrophe ausgelöst, aber dass diese beiden menschlichen Züge überhaupt zueinanderfinden konnten, sei gesetzlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zuzuschreiben, die auf bewusst getroffene politische Entscheidungen zurückgingen.
Magisches Denken
Politik und Wirtschaft aber, so ergänzt Nick Paumgarten im selben Heft, seien ohne jede wissenschaftliche Absicherung vorgegangen. Es habe eher eine Art „magisches Denken“ vorgeherrscht, in dem die Bereitschaft, zu glauben, dass, wer sich etwas wünscht, es auch bekommt, unbegrenzt sei. Mit einer gehörigen Prise Galgenhumor schlägt Paumgarten vor, das „magische Denken“ auch in der Krise anzuwenden und so Schlechtes in Gutes, Betrübliches in Erfreuliches zu verwandeln. Kollabierte die Wall Street und drohte New York wie Mitte der siebziger Jahre in den Bankrott zu schlittern, könnte Manhattan doch endlich wieder erschwinglich werden und cool und künstlerisch auf der Höhe der Zeit. Die Krise als Jungbrunnen der Stadt? Warum nicht, und über wahrscheinliche Nebenwirkungen wie eine verfallende Infrastruktur und steigende Kriminalitätsraten reden wir ein andermal.
Auf Vertrauen gründet alles
James Surowiecki führt uns zurück in die Wirklichkeit, deren ökonomische Kalamitäten er vor allem dem neuentwickelten Eifer von Finanzhäusern zuschreibt, an die Börse zu gehen. Dadurch seien sie gezwungen worden, ihre Finanzen offenzulegen, und hätten sich einer permanenten Volksabstimmung in Form von Aktienkursen ausgesetzt. Der Untergang von Lehman Brothers zum Beispiel sei nicht als Folge leerer Kassen, sondern des Mangels an Vertrauen zu begreifen. Auf Vertrauen aber gründe sich das gesamte Konstrukt namens Wall Street. Wolle der Finanzplatz überleben, müsse er sich an eine Grundregel erinnern, die beim Spiel mit dem Geld anderer Leute gelte: Der Spaß währt nur so lange, bis das Geld zurückgefordert wird. Im „New York Magazine“ entwirft ausgerechnet James J. Cramer, ein Börsenpropagandist, der nach wie vor auch im Fernsehen lautstark und unablässig fürs Aktienspiel wirbt, einen Ausweg aus der Krise. Der fundamentale Wandel, wie er ihn fordert, bezieht sich auf die Bereitschaft, Risiken einzugehen oder zu vermeiden. Niemand soll mehr neidisch auf Hedge-Fonds schauen, die Cramer plötzlich als „schleimig“ bezeichnet. Das Heil liege vielmehr in altmodischen ortansässigen Sparkassen, die noch wissen, wer bei ihnen Darlehen aufgenommen hat, und anstelle komplexer Finanzinstrumente mit einfachen, einsehbaren Transaktionen ihr Geld machen. Zu dumm nur, dass dabei nicht so viel Profit herauskommt wie bei den atemraubenden, aber zwielichtigen Bravourakten der nun diskreditierten Meister des Universums. Deren Zeit, so Cramer, sei ein für alle Mal vorbei. Eine „keuschere Kultur“ könne die Welt in der Wall Street und darüber hinaus gewiss bald kennenlernen. Sicherheit werde sexy sein.
Depressionsmonopoly
Selbst im unkorrigierbar neokonservativen „Weekly Standard“, der dem Staat gewohnheitsmäßig vorwirft, sich viel zu viel ins amerikanische Leben einzumischen, kritisiert Lawrence B. Lindsey die „Ad-hoc-Methoden“ der Regierung bei der Aufstellung von Regeln. Zu erwarten seien jetzt Untersuchungen durch Staatsanwälte und Bundesbehörden, endlose Gerichtsverfahren und wahrscheinlich ein dauerhaft beschädigter Ruf der amerikanischen Finanzmärkte: „Das ist der Preis, den wir alle auf Jahrzehnte hinaus zu zahlen haben. Wie wir gerade lernen, macht es keinen Spaß, Depressionsmonopoly zu spielen.“ Auch „Newsweek“ ruft nach einem Retter, der da heißt „Big Government“. Märkte, schreibt Fareed Zakaria, könnten nicht ohne Regeln existieren. Nachdem sie alles falsch gemacht hätten, machten die Regierung und die Bundesbank nun vieles richtig. Ob das reiche, die Krise zu meistern, wisse freilich niemand. Aber einen anderen Lösungsversuch als eine große systematische Regierungsintervention habe es nicht gegeben. Denn der moderne Kapitalismus beruhe auf Kredit, und Kredit beruhe auf Vertrauen. Dieses Vertrauen sei jedoch durch Angst ersetzt worden. Wie sich nun herausstelle, könne allein die Regierung jene psychologische Lähmung behandeln. Die Krise, versichert Zakaria, beende die falsche Debatte um Staat und Markt und deren angebliche Unvereinbarkeit. Staaten brächten Märkte hervor, die wiederum Regeln brauchten, um von Bestand zu sein.
Es gibt Hoffnung
„Ode“, die Zeitschrift, die sich an „intelligente Optimisten“ wendet, bringt unerwartet Trost. Zu scheitern, hat Marisa Taylor herausgefunden, sei zwar eine der unangenehmsten Erfahrungen des Lebens, aber nichts sei für den Erfolg notwendiger. Taylor zitiert zunächst J. K. Rowling, die bei der letzten Abschlussfeier in Harvard dem abgehenden Jahrgang 2008 zurief: „Das Wissen darum, dass ihr weiser und stärker aus Rückschlägen hervorgeht, bedeutet, dass ihr auf immer und ewig auf eure Fähigkeit zu überleben vertrauen könnt. Ihr werdet nie wirklich euch selbst oder die Stärke eurer Beziehungen kennen, bis beides von Not und Widrigkeit getestet wurde.“ Dann erinnert Taylor an Beethoven, der taub wurde und dennoch weiterkomponierte, und an Abraham Lincoln, der einen Nervenzusammenbruch erlitt und dennoch im Weißen Haus eine gute Figur abgab, und an Winston Churchill, der in der sechsten Klasse sitzenblieb, und an Michael Jordan, der es beim ersten Anlauf nicht in die Basketballmannschaft seiner Highschool schaffte.Scheitern, folgert Taylor, dabei gestützt auf Forschungsergebnisse der in Stanford wirkenden Psychologin Carol Dweck, sei eine Lernmöglichkeit. Vielleicht sogar für die gescheiterten Meister des Universums.
Verlierer des Universums
Moderator: Pierre Rappazzo
Forumsregeln
In diesem Forum finden Sie Beträge, die der SORGIM Vorstand nicht innerhalb der SORGIM Diskussion, um die Migros oder um die direkte demokratische Unternehmensführung sieht. In einer Demokratie muss aber auch Platz für andere Meinungen sein, dieser Platz ist hier.
In diesem Forum finden Sie Beträge, die der SORGIM Vorstand nicht innerhalb der SORGIM Diskussion, um die Migros oder um die direkte demokratische Unternehmensführung sieht. In einer Demokratie muss aber auch Platz für andere Meinungen sein, dieser Platz ist hier.
1 Beitrag • Seite 1 von 1
1 Beitrag • Seite 1 von 1
Zurück zu Politik und Wirtschaft
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste